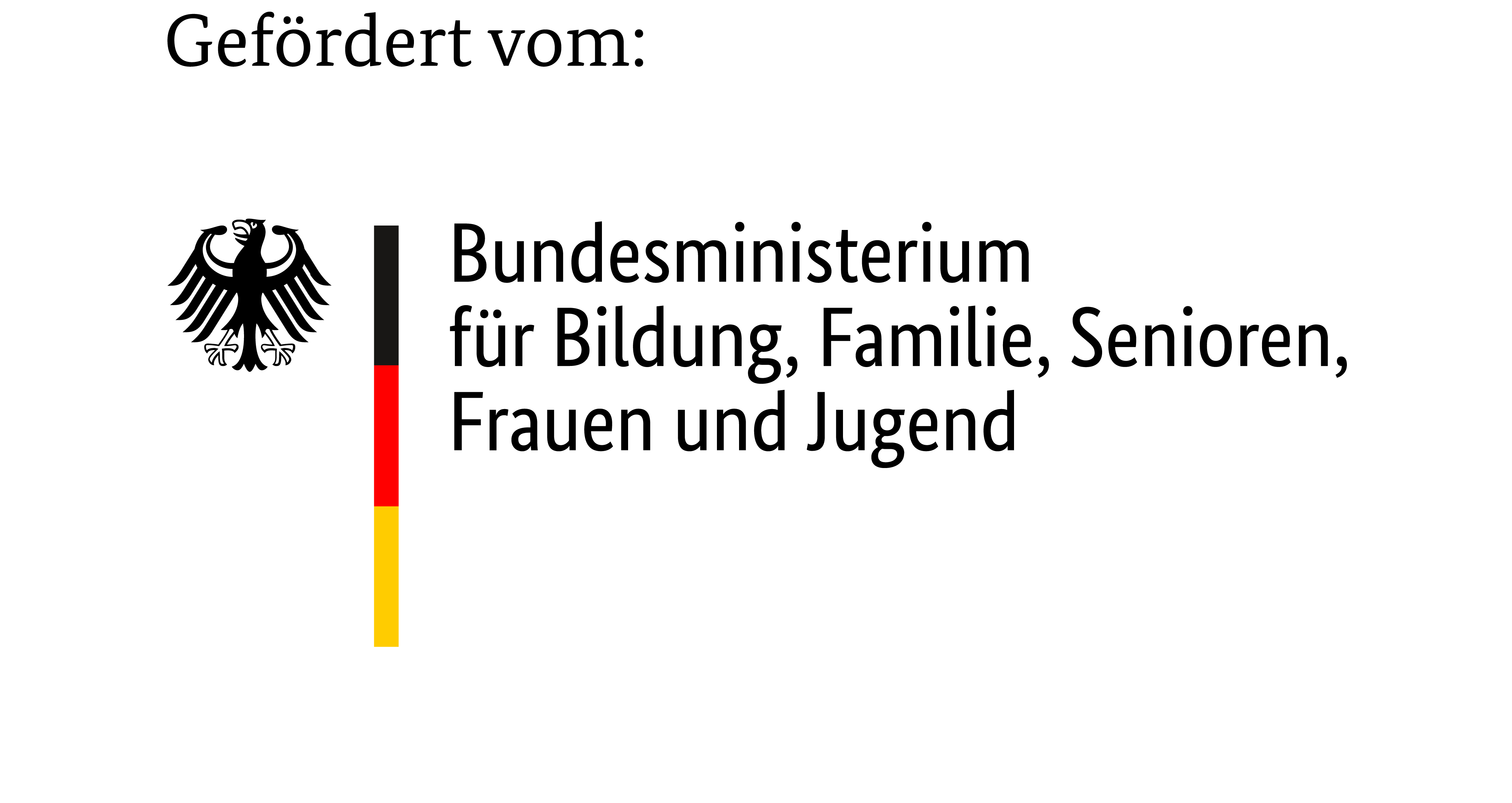Unter Diversitätsdimensionen versteht man alle individuellen Nuancen, die uns als Individuen ausmachen. Je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr verschiedene Merkmale fallen uns ein, die uns ausmachen.
Marilyn Loden und Judy Rosener entwickelten 1991 in den USA das erste Diversitätsrad als Übersicht solcher Merkmale, ursprünglich für Unternehmen und deren Managements. Das Buch hat den Namen „Workforce America Managing Employee Diversity as a Vital Resource“ (auf Deutsch: „Arbeitskraft Amerika – das Verwalten von Mitarbeiterdiversität als vitale Ressource“) und erklärt anhand von Studien, dass eine Diversität von Talenten und Kompetenzen im Arbeitsumfeld zu Unternehmenserfolg führt.
Diese Annahme ist heute noch aktuell und wird durch verschiedene Studien immer wieder bestätigt. Eine letzte Studie von der weltführenden Unternehmensberatungen McKinsey von 2024 besagt, dass europäische Unternehmen mit einem diversen Führungsteam bis zu 60% erfolgreicher sind. Es gibt mittlerweile mehrere Versionen dieses Rades: je nach Fokus werden weitere Ebenen hinzugefügt.
Hier eine bunte Darstellung des Diversitätsrades: Die farblichen Nuancen machen die unterschiedlichen Dimensionen auf einen Blick gut sichtbar. Der innere Kreis beinhaltet die Merkmale, die nicht zu verändern sind.











 Kommentare
Kommentare